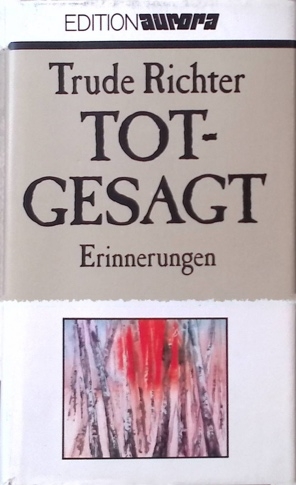19.11.1899 Magdeburg – 04.01.1989 Leipzig
Erna Johanna Marie Barnick, alias Trude Richter, alias Gertruda Friedrichowa, wurde am 19.11.1899 in Magdeburg geboren und starb am 4.1.1989 in Leipzig. Zwischen diesen Städten liegen nur 130 Kilometer, einen Großteil ihres Lebens, abgestempelt mit einem eigenem Namen, nämlich Gertruda Friedrichowa, musste sie jedoch für 14 unendlich lange Jahre über 12.000 Kilometer entfernt in den berüchtigten Gulags (Hauptverwaltung der Besserungslager und -Kolonien) an der Kolyma 1936-1946 und in Ust-Omtschug 1949-1953 interniert verbringen. Von 1946-1949 arbeitete sie als Garderobenfrau, zwangsverpflichtet, in Magadan.
Sie hatte Germanistik, Philosophie, Theologie, Geschichte und Kunstgeschichte studiert und 1924 über Gerhard Hauptmanns Erzähltechnik promoviert, trat 1931 in die Kommunistische Partei Deutschlands ein und nahm kurz darauf den Namen Trude Richter an.
1932 wurde sie erste Sekretärin des Bundes Proletarisch-Revolutionärer Schriftsteller, 1934 folgte sie ihrem Lebensgefährten Hans Günther (1899-1938), marxistischer Nationalökonom, ins Exil in die Sowjetunion nach Moskau. Am 3.11.1936 erhielt Trude Richter die sowjetische Staatsbürgerschaft, einen Tag später erfolgte Ihre Verhaftung und Einlieferung in die Untersuchungshaft. Gemeinsam mit Hans Günther wurden sie wegen konterrevolutionärer, trotzkistischer Tätigkeit verurteilt und nach Sibirien in den Gulag verbannt. Hans Günther verstarb in einem Lager in Wladiwostok an Typhus, Trude Richter kehrte nach der Haftentlassung 1953 nach Moskau zurück, wurde wieder in die Kommunistische Partei aufgenommen, aber erst drei Jahre später offiziell rehabilitiert.
1957, nach entschiedener Intervention von Anna Seghers, kehrt sie in die DDR zurück und beginnt ihr neues Leben. Ungebrochen, unbeugsam will sie mitgestalten am Aufbau einer Gesellschaft, die sich „Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus“ auf die Fahnen geschrieben hat. Sie wird Dozentin am Leipziger Literaturinstitut Johannes R. Becher, ist Mentorin u.a. von Hans Weber, Horst Salomon, Max Walter Schulz, Günter Görlich, Helmut Richter.
In den 60er Jahren begann sie ihre Erfahrungen der durchlittenen Lagerhaft aufzuschreiben. Ist es Zufall oder braucht es die Zeit der Überdenkung des Geschehenen, bis die Opfer der stalinistischen Repressionen literarisch beginnen, diese zu verarbeiten?
Alexander Solschenizyn, während des Krieges gegen Hitlerdeutschland für seine Verdienste mit hohen sowjetischen Orden dekoriert, wird 1945 wegen Kritik an Stalin verhaftet und bis 1953 im Gulag inhaftiert, anschließend bis 1957 verbannt. Sein Werk „ Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch“ erscheint 1962, sechs Jahre später „Der erste Kreis der Hölle“. 1970 bekommt er den Nobelpreis, sein „Archipel Gulag“ wird 1973 nach erneuter Verhaftung und sofortiger Ausweisung im Ausland veröffentlicht.
Trude Richters 1972 gedruckte Autobiografie „Die Plakette“ sparte die ihr gestohlene Lebenszeit der Lagerhaft aus, sie hielt sich an das Schweigegebot der Partei, nicht darüber zu berichten. Erst 1988, im zweiten Anlauf nach 1984, setzte Max Walter Schulz, ihr ehemaliger Student und mittlerweile langjähriger Chefredakteur von Sinn und Form, Zeitschrift der Akademie der Künste, durch, einen Auszug aus der Lagerzeit dort erscheinen zu lassen.
Trude Richter, seit 1987 Mitglied im Vorstand des Schriftstellerverbandes der DDR, mit dem Vaterländischen Verdienstorden, dem Großen Stern der Völkerfreundschaft, der Johannes R. Becher Medaille geehrt, verbrachte die letzten drei Lebensjahre in einen Feierabendheim und wurde 1989 im Ehrenhain für die Kämpfer gegen den Faschismus auf dem Leipziger Südfriedhof beigesetzt. Das Buch ihrer gesamten Lebensgeschichte „Totgesagt. Erinnerungen“ konnte sie nicht mehr in den Händen halten, es erschien erst 1990 in den letzten Atemzügen der DDR.
Text: Dr. Helmuth Markov