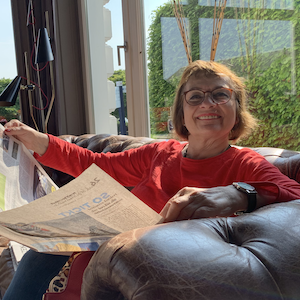Aufrecht.
Trotz lebenslanger schwerer Krankheit hat Gerhard W. Menzel über zwei Dutzend Hörspiele bearbeitet und geschrieben, das erfolgreichste Theaterstück der frühen 50er Jahre geschaf- fen, Erzählungen, Novellen, vier Romane, zwei Kinderbücher und zwei große Kunstmonografien veröffentlicht.
Menzel war ein früh Vollendeter und ist mit gerade 58 Jahren auch früh gestorben. Sein Vater, SPD-Genosse, aktiver Gewerkschafter und Roter Elternrat in Sachsen wurde vier Wochen nach Hitlers Machtantritt entlassen und zu zwölf Jahren schwerer Zwangsarbeit ver- pflichtet. Die Mutter starb früh. Was ein entbehrungsreiches, aufrechtes Leben war, wusste er. Diese beiden Pole ziehen sich durch sein Leben. Den Erfolg hat er sich hart erkämpft. Nach der Buchhändlerlehre in Leipzig wurde er 1938 zum Arbeitsdienst eingezogen, wo er lebensgefährlich an TBC erkrankte und sich nie wieder erholte. Sieben Jahre hatte er in Hit- lers Lazaretten Zeit zu lesen, selbst zu schreiben und zu zeichnen. Sein Thema fand er 1947 als Hörspieldramaturg des Mitteldeutschen Rundfunks. Seine Hörspiele waren geschickte Bearbeitungen weltliterarischer Vorlagen wie des Schwejk oder die eigene Suche nach aufrechten Vorbildern in der Geschichte.
Menzel gilt als „Vater des Hörspiels der DDR“. Mit sei- nem politischen Rückzug nach dem 17. Juni 1953 wandte er sich der Epik zu, den kultur- politischen Forderungen nach Gegenwartsstoffen aus der Produktion folgte er jedoch nicht, weil mit dem Bitterfelder Weg die Welt der Werktätigen von Künstlern nur simuliert wurde. Einerseits war er sehr erfolgreich mit seinem Thema der Darstellung außergewöhnlicher Persönlichkeiten in ihrer Zeit. Andererseits setzte er der stark ideologisierten Literatur der DDR bewusst die exakte wissenschaftliche Forschung als Schaffensprinzip entgegen. Damit entzog er sich den schweren kulturpolitischen Diskussionen.
Menzels Geradlinigkeit hatte stets einen hohen Preis: Winzige Auflagen, begrenzte Möglichkeiten der Ausstattung der Bücher und bis 1979 die Ignoranz der Rezensenten in den Medien. 1975 waren 25.000 Exemplare seines Romans „Die Truppe des Moliére“, sein künstlerisches Meisterwerk, ohne Werbung und Rezension in vierzehn Tagen ausverkauft. Seine Kinderbücher „Clown Pallawatsch“ (1959), eine moderne Emil-und-die-Detektive-Geschichte und „Der weiße Delphin“ (1962) wurden Schullesestoff. Seine Kunstmonografie über Pieter Bruegel d. Ä. (1966) gilt als der internationale Durchbruch in der Bruegel-Forschung.
Menzel wollte für sich und seine Zeit die Frage beantworten, welchen Einfluss kulturelle Vorstellungen darauf haben, welchen Erzählungen wir glauben. Und wann wir Menschen anfangen, die Erzählungen anderer zu hinterfragen.
Familie Menzel hatte keinen Fernseher, aber einen riesengroßen Briefkasten. Durch ihn kam die Welt zu Gast. Zu diesem Freundeskreis zählten der Chefdramaturg des Leipziger Schau- spielhauses, Dr. Franz Hauptman, der Komponist Paul Dessau, der mit ihm an einer Oper arbeitete, Professor Dr. h.c. Gerhard Keil, der Studienfreund und spätere langjährige Verleger des E. A. Seemann Verlages, die Leipziger Übersetzer Hans und Ilse Seiffert, Dr. Hanns Georgi, der letzte Spätimpressionist der DDR und kongeniale Illustrator Menzels beider erster Ro- mane. Mit dem Maler und Illustrator Max Schwimmer traf sich Menzel oft. Auch Paul Engel Rosenfeld, der von Ecuadors Hauptstadt Quito aus unter dem Pseudonym Diego Viga seine Romane über Südamerika schrieb. All diese Menschen waren für Menzel Augen in die Welt. Unter den Leipziger Kollegen schätzte Menzel besonders den Lyriker Georg Maurer, die Er- zähler Erich Loest und Joachim Nowotny und Hans Pfeiffer.
Hat Gerhard W. Menzel sich der Aufgabe seiner Generation künstlerisch gestellt? Ja, weil nach der Erfahrung der Nazizeit ein tiefes demokratisches Grundanliegen seine Werke durch- zog. Nein, beziehungsweise noch nicht, weil er sich der Erfahrungen seiner, der Stalingrad- Generation, literarisch nicht direkt gestellt hat. Seine Erlebnisse in Hitlers Lazaretten haben Menzel bis zum Schluss gepeinigt. Einem Roman dazu fühlte er sich noch nicht gewachsen. Aufrechtes Leben im sozialistischen System – ja, es war möglich. Gerhard W. und Dora Men- zel haben es gelebt. und ihre Kinder gelehrt, wie das geht.
Gerhard W. Menzel erhielt 1966 den Kunstpreis der Stadt Leipzig und 1979 den "Lion Feuchtwanger-Preis" der Akademie der Künste.

©Vortrag Dagmar Winklhofer-Bülow, Tochter von Schriftsteller Gerhard W. Menzel. Rede veröffentlicht am 18.02.2022 in Leipzig.