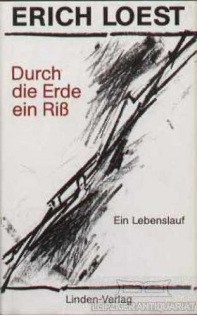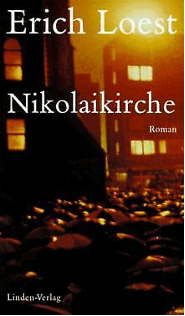Erich Loest
24.02.1926 Mittweida - 12.09.2013 Leipzig

Vier Deutschland und harte Brüche hat Erich Loest als ein „Chronist der gesamtdeutschen Gesellschaft“ erlebt und literarisch verarbeitet.
1926 im sächsischen Mittweida geboren, zog es ihn sofort nach Kriegsdienst und US-Gefangenschaft wieder nach Sachsen. Sein erster Roman „Jungen die übrig blieben“ erschien bereits 1950. Zuvor hatte er unter anderem als Redakteur bei der Leipziger Volkszeitung gearbeitet. 1955 begann er ein Studium am Leipziger Literaturinstitut.
Von 1957 bis 1964 wurde Loest als Häftling 23/59 wegen „konterrevolutionärer Gruppenbildung“ und kritischen Texten in den Zuchthäusern Halle und Bautzen II inhaftiert. Dass er daran weder zerbrochen ist noch zum Hasser und Rächer wurde, sondern sofort wieder schrieb, bezeichnete sein Freund Günter Grass später als Zeichen von Größe. Noch 1995 lässt Loest eine Figur seines Romans „Nikolaikirche“ sagen: „In Bautzen verschwunden, das schüttelte einer lebenslänglich nicht ab.“Als ob er diese „gemordete Zeit“ wett machen wolle, schrieb Loest unermüdlich. Unter seinem Namen und unter Pseudonymen entstand ein reiches Oeuvre an Romanen, Erzählungen, Filmen, Hörspielen und Kriminalromanen. Die Biografie über den Sachsen Karl May, „Swallow, mein tapferer Mustang“ läutete nach 1980 unbeabsichtigt eine Karl-May-Renaissance in der DDR ein. „Durch die Erde ein Riss“, Loests Autobiografie, druckte kein DDR-Verlag.
1978 erschien gleichzeitig im Mitteldeutschen Verlag Halle und in der Deutschen Verlagsanstalt Stuttgart sein Roman „Es geht seinen Gang oder Mühen in unserer Ebene“. Dass er darin das wie im Mehltau erstickte Leben eines durchaus privilegierten Leipziger Ingenieurs als das Verrinnen von Zeit in Langeweile, Routinen, Stagnation und Selbstbescheidung beschreibt, konnte den Zensoren der DDR nicht gefallen.
Die Bespitzelungen der Familie und die Auseinandersetzungen mit Kulturpolitikern führten 1979 dazu, dass Loest einem Ausschluss aus dem Schriftstellerverband der DDR durch Austritt zuvorkam. Damit hatte er sich der Veröffentlichungsmöglichkeiten in der DDR begeben und stellte den Antrag auf ein Auslandsvisum. Im März 1981 verließ Erich Loest die DDR, Frau und Kinder kamen nach. Er sprach von sich selbst als „ein doppelter Deutscher“.
In Osnabrück und Bonn entfaltete Loest seit 1981 eine enorme literarische und kulturpolitische Produktivität. Jahr für Jahr erscheinen Romane, darunter 1981 die Autobiografie „Durch die Erde ein Riss“, 1984 „Völkerschlachtdenkmal“, 1985 „Zwiebelmuster“ – das Thema Leipzig, die deutsche Teilung und die Wiedervereinigung ließen ihn nicht mehr los. Er hatte ein untrügliches Gespür für packende Themen und fand sie auch nach der Ausreise reichlich im Leipzig seiner Zeit.
1988 gründete er mit Schwiegertochter und Sohn Thomas den Linden-Verlag, der ausschließlich Loests eigene Werke, auch eine Werkausgebe, edierte.
Im Dezember 1989 las er erstmals wieder Leipzig, im Gohliser Schlößchen. 1990 zog zuerst der Linden-Verlag, dann Loest zurück nach Leipzig. Zuvor hatte im April 1990 das Oberste Gericht der DDR Erich Loest voll rehabilitiert.
Nachdem er die 32 Ordner mit je 300 Seiten seiner Stasiakte gelesen hatte, veröffentlichte er Auszüge daraus 1991 in dem Band „Die Stasi war mein Eckermann“.
In dem von Starregisseur Frank Beyer gedrehten zweiteiligen Fernsehfilm und den gleichzeitig erschienenen Roman „Nikolaikirche“ setzte Loest 1995 der friedlichen Revolution in Leipzig und ihren Protagonisten wie dem großartigen Pfarrer Christian Führer ein bleibendes Denkmal. Von dort waren Jahre vor der großen Leipziger Demonstration am 9. Oktober 1989 die montäglichen Friedensgebete ausgegangen.
Loests Credo in den Jahren nach der Wende war: “Umdenken ist schwer. Umfühlen aber noch schwerer.“
Von 1994 bis 1997 war Erich Loest Vorsitzender des Verbandes deutscher Schriftsteller. Er erfuhr viele hohe Ehrungen, beispielsweise als Mitglied der Sächsischen Akademie der Künste, des PEN – Zentrums und als Mittweidaer und Leipziger Ehrenbürger.
Am 12. September 2013 beging Erich Loest mit 87 Jahren durch einen Sprung aus dem Fenster der Leipziger Universitätsklinik Selbstmord.
Die ergreifende Trauerrede hielt auf Loests Wunsch der bekannte Bürgerrechtler Werner Schulz in der Nikolaikirche. Darin sagte er: „Sein Leben war geprägt von den großen Malaisen der Geschichte" und "Wer unsere Geschichte kennen und verstehen will, kommt am Werk von Erich Loest nicht vorbei".
1926 im sächsischen Mittweida geboren, zog es ihn sofort nach Kriegsdienst und US-Gefangenschaft wieder nach Sachsen. Sein erster Roman „Jungen die übrig blieben“ erschien bereits 1950. Zuvor hatte er unter anderem als Redakteur bei der Leipziger Volkszeitung gearbeitet. 1955 begann er ein Studium am Leipziger Literaturinstitut.
Von 1957 bis 1964 wurde Loest als Häftling 23/59 wegen „konterrevolutionärer Gruppenbildung“ und kritischen Texten in den Zuchthäusern Halle und Bautzen II inhaftiert. Dass er daran weder zerbrochen ist noch zum Hasser und Rächer wurde, sondern sofort wieder schrieb, bezeichnete sein Freund Günter Grass später als Zeichen von Größe. Noch 1995 lässt Loest eine Figur seines Romans „Nikolaikirche“ sagen: „In Bautzen verschwunden, das schüttelte einer lebenslänglich nicht ab.“